Das Angebot an SmartHome-Systemen nimmt rasant zu. Die große Ge-meinsamkeit besteht darin, dass fast alle Hersteller versprechen, mit je-weils ihrer Technologie beliebige Wünsche der Kunden erfüllen zu können.
In einem umfangreichen Whitepaper wurden zumindest die beiden großen Fraktionen miteinander vergleichen – im Detail die „Komplettsysteme“ versus „professionelle Vollsortimenter“ – und deutliche Unterschiede erarbeitet.
Komplettsysteme versus professionelle Vollsortimenter
Als Komplettsysteme werden im Folgenden Systeme bezeichnet, die von einem Hersteller angebo-ten werden und eine in sich geschlossene Lösung sind. Die verfügbaren Komponenten wie Senso-ren, Aktoren und Controller sind aufeinander abgestimmt. Die Einrichtung und Programmierung erfolgt üblicherweise über eine App, die ein interessierter Kunde selber über das Smartphone oder ein Tablet durchführen kann.
Im Gegensatz dazu stehen funk- und BUS-basierte Technologien wie z.B. EnOcean oder KNX zur Verfügung. Entsprechende Komponenten werden jeweils in einer großen Anzahl von unterschiedli-chen Herstellern angeboten und somit ist das Angebot an verfügbaren Komponenten ausgespro-chen hoch und kann interoperabel gemischt werden. Die Einrichtung erfolgt meist mit Hilfe einer PC-basierten Programmiersoftware, deren Ergebnis auf die Komponenten übertragen wird. Diese Technologien werden im Folgenden als „professionelle Technologien“ bezeichnet.
Ergebnisse des Vergleichs
Beim Vergleich dieser beiden Fraktionen hat sich gezeigt, dass die „Komplettsysteme“ einen Kos-tenvorteil haben können. Zum einen sind die Komponentenkosten üblicherweise (etwas) geringer und parallel können diese Systeme einfacher und schneller eingerichtet werden.
Allerdings muss beachtet werden, dass ein fairer Vergleich nur dann durchgeführt werden kann, wenn ein begrenzter Anspruch an die Funktionalität des Gesamtsystems erhoben wird. Wenn auf-grund der Anforderungen nicht nur Standardkomponenten, sondern auch spezifischere Sensoren und Aktoren, nicht nur funk‑, sondern auch kabelbasierte Anbindung, nicht nur Standardfunktionen, sondern eine spezifische Programmierung erforderlich sind, dann ist das mit den Komplettsystemen üblicherweise nicht durchführbar. Beim Thema Funktionalität sind die professionellen Systeme somit klar im Vorteil.
Auch beim Vergleich weiterer Aspekte setzen sich die professionellen Technologien deutlich von den Komplettsystemen ab. In Bezug auf die Ausfallsicherheit ist es hilfreich, wenn sich Aktoren und Sensoren direkt miteinander verknüpfen lassen – d.h. nicht nur über eine einzige zentrale Instanz. Zur Integration in ein bestehendes Schalterprogramm (d.h. dem Mix mit normalen Schaltern, Steckdosen und Blendrahmen) ist eine hohe Design-Vielfalt der Komponenten wichtig. Wichtig sind auch professionelle Mess- und Testmöglichkeiten – insbesondere in größeren Projekten ist das ausgesprochen wichtig, falls der eine oder andere Aktor nicht genau das ausführt, was geplant wurde.
Eine Übersicht der Kriterien und Bewertungen zeigt die abgebildete Tabelle.
| Bewertungsaspekte | Komplettsystem | Professionelle Technologien | |
| Funktionalität | Verfügbare Kompo-nenten | Begrenztes Angebot an Sensoren und Aktoren | Beliebige Sensoren und Aktoren einbindbar (notfalls direkt an den Controller) |
| Topologie-Flexibilität | Üblicherweise nur funkbasierte Anbindung; dabei ein Controller als zwingende zentrale Komponente (funkbasierte Sterntopologie) | Flexibilität in Bezug auf funk‑, BUS- und direkte Anbindung (Masche, BUS/Baum und Stern) – dabei auch in beliebiger Kombination | |
| Leistungs-fähigkeit des Controllers | Einfache App-basierte Einrichtung und Programmierung; reduzierte Funktionen (z.B. einfache Regeln); Beschränkung auf vordefinierte/unterstützte Sensoren und Aktoren | Anspruchsvolle Programmierung über PC-basierte Software; dafür komplett freie/beliebige Programmierung möglich; keine Einschränkungen in Bezug auf Sensoren/Aktoren | |
| Erweiter- barkeit /Skalierung |
Beschränkte Skalierung (meist nur ein Controller-Typ verfügbar für sowohl einfache als auch umfangreiche Projekte) | Beliebig skalierbar (von ersten Sensoren und Aktoren in Direktkopplung bis hin zu beliebigen professionellen Controllern) | |
| Ausfallsicherheit | Manuelle Bedienung je nach Aktor teilweise gegeben; bei Controller-Ausfall ist meist das gesamte System betroffen | Alle Aktoren bei Bedarf mit Handbedienung möglich; ergänzend können elementare Funktionen (Temperatur, Licht, Verschattung) so geplant werden, dass diese auch bei Controller-Ausfall nicht betroffen sind | |
| Design-Vielfalt | Üblicherweise nur ein oder wenige Designs für Taster etc. verfügbar; somit deutliche Design-Unterschiede zum Schalterprogram (Lichtschalter, Steckdosen etc.) wahrscheinlich | Hohe Design-Vielfalt bei den Sensoren und Aktoren verfügbar; Harmonisierung mit dem Schalterprogramm (Lichtschalter, Steckdosen etc.) wahrscheinlich | |
| IT-Sicherheit | Die Art des Fernzugriffs ist üblicherweise auf eine Variante beschränkte; teilweise sogar verpflichtend | Volle Gestaltungsfreiheit dahingehend, ob ein Fernzugriff eingerichtet wird und unter welchen Sicherheitsaspekten | |
| Nach- und Notfallbetreuung | Üblicherweise nicht verfügbar (d.h. Beschränkung auf Hotline des Herstellers und ggfls. Community-Webseiten) | Möglichkeit zur unmittelbaren oder alternativ späteren Einbindung eines Systemintegrators | |
| Mess- und Testmöglich-keiten | Üblicherweise keine oder nur eingeschränkte Mess- und Testmöglichkeiten (wenn überhaupt, lediglich Anzeige von Signalstärken am Standort des Controllers) | Umfangreiche Mess- und Testmöglichkeiten (externe Testgeräte zur Messung von Signalstärken an beliebigen Stellen in der Immobilie); Anzeigemöglichkeit der übermittelten Daten zwischen Komponenten; Verfügbarkeit entsprechender Dokumentation zur Interpretation | |
| Investitions-schutz | Risiko von Produktabkündigungen in mehreren Jahren; somit Risiko, Komponenten später nicht nachkaufen oder ersetzen zu können | Hohe Wahrscheinlichkeit bezüglich Nachkaufs- und Ersatzbeschaffungs-Möglichkeit in mehreren Jahren – notfalls über einen anderen Hersteller | |
| Gesamtkosten | Kostenersparnis aufgrund der zwangsläufigen Eigendurchführung von Planung, Installation und Inbetriebnahme; | Kostenersparnis bei Eigendurchführung von Planung, Installation und Inbetriebnahme möglich; | |
| Kosten der Komponenten etwas günstiger als professionelle Technologien | Etwas höhere Kosten der Komponenten; Höhere Kosten bei Einbindung von Systemintegratoren (sofern gewünscht – z.B. bei wachsender Komplexität) | ||
Ebenso sollte beachtet werden, ob ein Investitionsschutz gegeben ist – d.h. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nach- oder Ersatzbeschaffung von Komponenten einer Technologie auch nach 5, 10 oder noch mehr Jahren möglich ist.


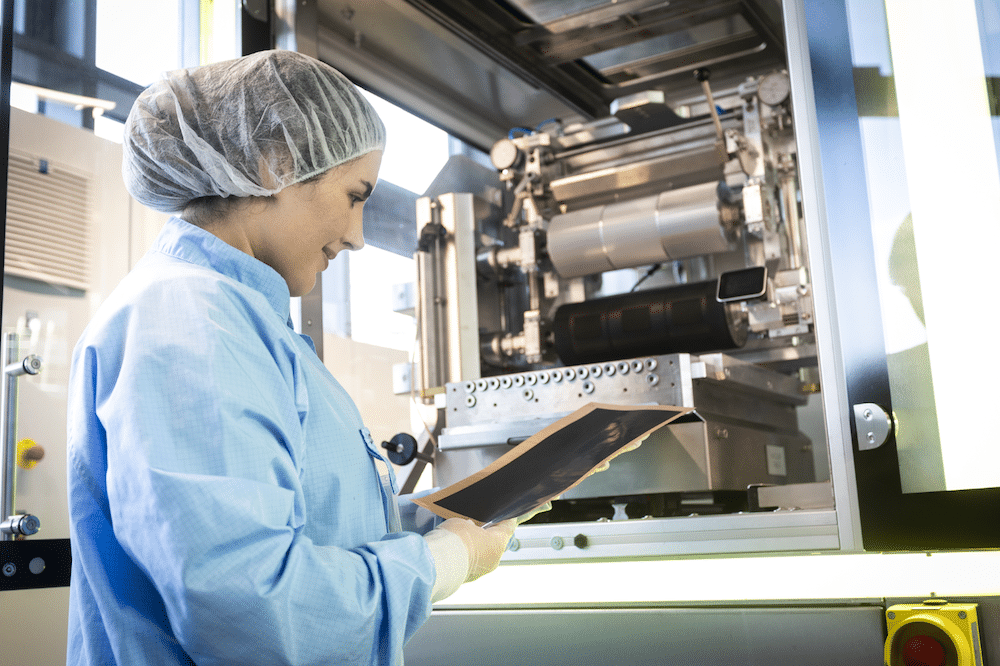



0 Kommentare