Das Berliner Stadtschloss ist ein umstrittener Bau. Gigantisch und an historisch belasteter Stelle, wo einst der bei Ostdeutschen beliebte Palast der Republik stand. Dabei wird das Schloss keineswegs ein Nachbau, sondern ein hochmoderner Komplex, der sich vor allem den schönen Künsten widmen. Zahlreiche Sammlungen sollen hier im so genannten Humboldt-Forum ihren Platz finden.
Kreativ wie die Kunst waren die Planer auch bei der Antwort auf die Frage, wie denn ein so großer Gebäudekomplex eigentlich zu heizen oder zu kühlen sei. Eine der möglichen – und nun auch realisierten – Lösungen: Geothermie. Der Berliner Untergrund eignet sich dafür recht gut. Seit 2009 sorgten unter anderem jeweils drei Erkundungsbohrungen und Geothermal Response Tests für die nötige Klarheit, dass es auch funktionieren könnte.
Im einzelnen gab es folgende Ergebnisse*:
- Untergrundtemperaturen bis 100 m zwischen 13,46 °C und 13,84 °C
- Effektive Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes: zwischen 2,8 W/(mK) und 2,5 W/(mK)

Blick auf das Stadtschloss während der Bauphase. Die 115 Erdwärmesonden wurden auf dem Platz direkt neben dem Schloss untergebracht, die 91 Energiepfähle unter dem Gebäude vor der Kuppel. Foto: Szczecinolog /Wikimedia /Lizenz unter CC-BY-SA 4.0
Das war für das Vorhaben durchaus auskömmlich. Das Konzept sah nun 115 Erdwärmesonden bis 100 m Tiefe und 91 Energiepfähle mit 18,5 m Tiefe vor. Damit soll die Grundlast für Heizen (450 kW und 1.900 MWh je Jahr) und Kühlen (400 kW und 1.300 MWh je Jahr) gedeckt werden. Ab 2019, wenn der Betrieb planmäßig laufen soll, kann dann die Geothermie die Kunst wärmen.
* Die Daten entstammen einen Vortrag von Jens-Uwe Kühl, H.S.W. Ingenieurbüro für Energie und Umwelt mbH
Vorschaubild: Rohbau des Stadtschlosses, das dereinst zu großen Teilen mit Geothermie beheizt wird. Foto: Miriam Guterland /Wikimedia /Lizenz unter CC BY-SA 3.0


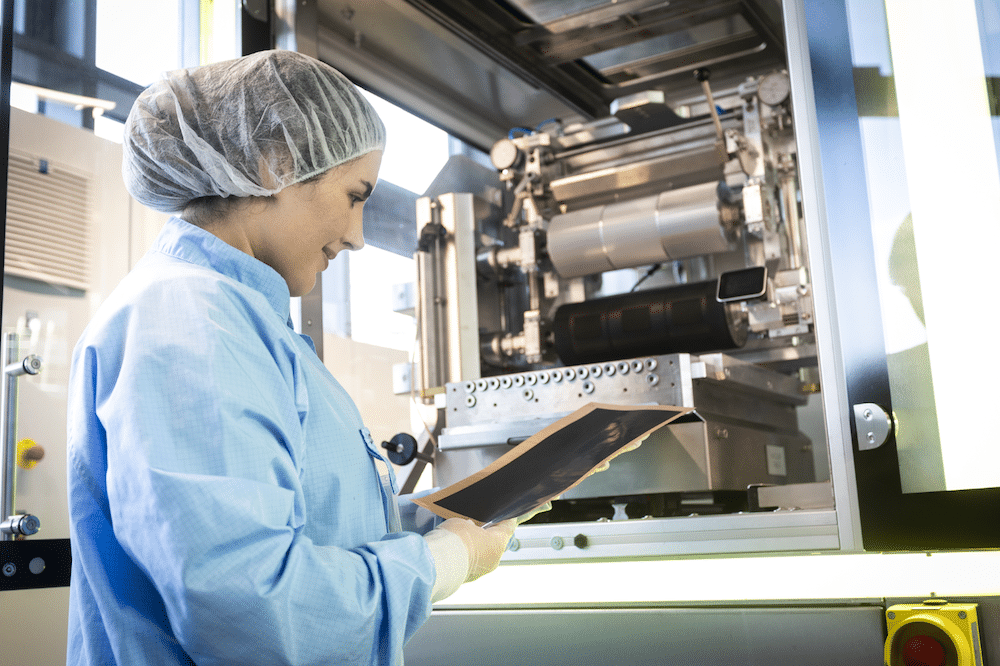



Schafft die Geoheizung das? Ich hab immer gelesen, dass die sich nicht so rentieren soll, weil es extrem viel Aufwand und Leistung kostet, die Wärme nach oben zu holen und den Raum entsprechend warm zu halten. Sind das falsche Infos? Wird das nicht einiges an Kosten geben, das Jahr über? Mal abgesehen davon, was wären dann die Alternativen.. Wahrscheinlich gibts da gar nicht mehr so viel dann.
Gruß
Silvia
Ob sie das schafft, wird erst die Praxis zeigen. Auf jeden Fall ist sie nur für die Grundlast ausgelegt. Das ist schon mal ein realistischerer Ansatz als ein Gebäude komplett mit Geothermie beheizen zu wollen. Die Spitzen werden – sicher ist sicher – mit konventioneller Energie, hier Fernwärme – abgedeckt.