Die Bundesregierung möchte ab 2050 elektrische Energie nur noch aus regenerativen Quellen gewinnen. In diesen Planungen ist für fossile Brennstoffe noch allenfalls Platz in der Industrie. Politiker quer durch alle Parteien, aber auch Wissenschaftler sind von der Machbarkeit dieser Pläne wenig überzeugt und räumen den fossilen Energieträgern auch in der Zukunft ihren Platz sowohl im Wärmemarkt als auch in der Stromerzeugung ein.
BRENNSTOFFSPIEGEL und mineralölrundschau sprach mit Prof. Dr. Jürgen Mlynek, dem Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten Forschungsorganisation in Deutschland, die auch in der Wärme- und Energietechnologieforschung führend ist.
Forscher aus Ihrem Verbund sind führend bei der Entwicklung von Verfahren für effiziente Nutzung fossiler Energien und deren Kombination mit den Erneuerbaren. Wo sehen Sie in der Zukunft den Platz für fossile Energien im Wärmemarkt und bei der Stromerzeugung?

Unser Gesprächspartner Prof. Dr. Jürgen Mlynek sieht auch für die fossilen Brennstoffe noch eine Zukunft.
Foto: Dawin Meckel
Mlynek: In den nächsten Jahrzehnten werden fossile Energieträger noch die Basis der Energieversorgung bilden, vor allem bei der Erzeugung von Prozess- und Heizwärme. Auch für Fahrzeuge, Flugzeuge und in der Schifffahrt sind fossile Rohstoffe noch nicht flächendeckend ersetzbar. Als eines der technologisch am weitesten fortgeschrittenen Länder ist Deutschland aber in der Pflicht, emissionsärmere Technologien voran zu treiben. Dazu gehört die Entwicklung von Hochtemperaturwerkstoffen für Dampfturbinen, die höheren Betriebstemperaturen standhalten. Diese Arbeiten finden am Forschungszentrum Jülich statt. So soll schon 2014 das erste E.ON-Dampfkraftwerk in Betrieb gehen, das Komponenten aus Hochtemperaturwerkstoffen einsetzt und bei 720 Grad betrieben werden kann. In etwa 20 Jahren wären damit in Kohlekraftwerken Wirkungsgrade von bis zu 55 Prozent und in Gaskraftwerken von bis zu 65 Prozent möglich.
Mehrere Helmholtz-Zentren arbeiten aber auch an der Abscheidung von Kohlendioxid und der anschließenden Speicherung in unterirdischen Endlagerstätten. Wir untersuchen, ob CCS (Carbon Capture and Storage) sicher ist und wie sich die Wirkungsgradverluste, die damit notwendigerweise einhergehen, minimieren lassen. Dazu betreiben wir gemeinsam mit Partnern aus der Industrie unter Federführung des Helmholtz-Zentrums Potsdam – Deutsches Geoforschungszentrum GFZ im brandenburgischen Ketzin eine Pilotanlage.
Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist die Speicherung von Wärme aus in Solaranlagen erzeugter Energie. Für den Wärmemarkt der Zukunft, der zum Teil aus unregelmäßig produzierenden regenerativen Energien abgedeckt werden soll, ist dies existenziell. Wird dies in absehbarer Zeit gelingen oder werden die Fossilen für sehr lange Zeit unverzichtbar bleiben?
Mlynek: In der Tat ist die Speicherung von Wärme ein zentraler Schlüssel beim Betrieb solarthermischer Kraftwerke. Wir haben hier große Fortschritte erreicht. Wärmespeicher aus Salzen oder aus Beton funktionieren in der Praxis, Helmholtz-Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben zum Beispiel die Speicher für das Andasol-1-Kraftwerk in Südspanien entwickelt, das dadurch 20 Stunden täglich Strom produziert. Deutlich schwieriger als die Speicherung von Wärme ist jedoch die Speicherung von Elektrizität. Hier bauen zwei Helmholtz-Zentren, das Forschungszentrum Jülich und das Karlsruher Institut für Technologie, gerade in Zusammenarbeit mit den Universitäten und Partnern aus der Industrie zwei neue Kompetenzverbünde auf, um die Batterieforschung voranzutreiben.
Inwieweit werden fossile Energieträger, vor allem Produkte aus Mineralöl, wegen ihrer hohen Energiedichte auch in naher Zukunft in mobilen Bereichen wie Schwerlasttransport, Luftverkehr und Schifffahrt unverzichtbar sein?
Mlynek: Wie schnell konventionelle Treibstoffe durch nachhaltig erzeugte Designertreibstoffe ersetzt werden können, ist eine offene Frage, die von vielen Randbedingungen abhängt. Potenzielle Ersatzstoffe gibt es schon, allerdings bislang nur in kleinen Mengen. Wir arbeiten zum Beispiel an einem neuen Verfahren, das aus landwirtschaftlichen Reststoffen hochwertigen Treibstoff herstellt. Dieses Bioliq-Verfahren wird am Karlsruher Institut für Technologie in einer Pilotanlage weiterentwickelt. Auch Wasserstoff kommt als Treibstoff für Fahrzeuge in Frage, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wird jetzt ein Leichtflugzeug getestet, das mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen fliegt.
Welchen Platz wird die Kohle im Energiemix der Zukunft einnehmen?
Mlynek: Kohle ist der Energieträger, der pro Kilowattstunde mit Abstand die meisten Treibhausgase freisetzt. Daher müssen wir entweder die noch in der Entwicklung befindlichen CCS-Technologien einsetzen, um Kohle „sauber“ zu nutzen oder auf andere Energieträger umsteigen. Wir müssen in den nächsten Jahren die Machbarkeit der Technologie demonstrieren, denn China und Indien und viele andere große Staaten werden noch sehr lange auf Kohle setzen, die billig und reichlich verfügbar ist. Ohne Clean-Coal-Technologien werden die Klimaveränderungen sehr viel drastischer ausfallen.
Geschrieben für Brennstoffspiegel und Mineralölrundschau.
Erschienen in Heft 09/2010: Vollständiger Beitrag nur dort zu lesen.
Titelbild: Forschungsschwerpunkt der Helmholtz-Gemeinschaft ist die Treibstoffgewinnung aus Pflanzenresten. Foto: Karlsruhe Institut für Technologie




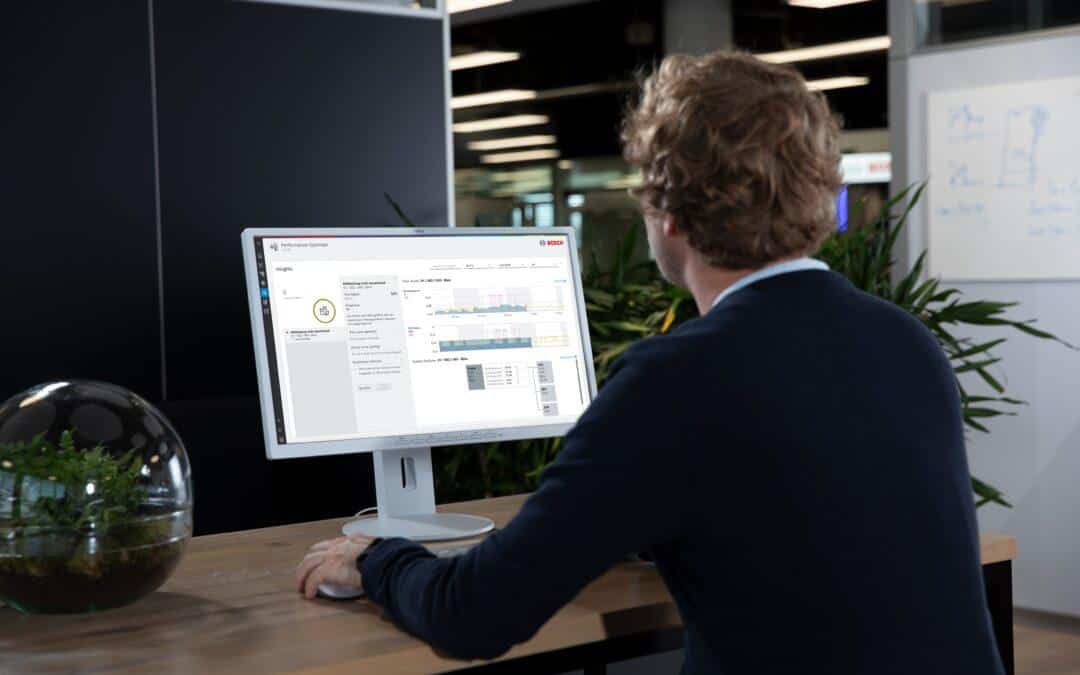
0 Kommentare