Eisspeicher als Energiequelle Wie ist Wärme aus einem Eisblock zu gewinnen? Das Prinzip ist denkbar einfach. Es beruht auf der beim Kristallisationsprozess abgegebenen Wärme.
In Deutschland sind bereits Lösungen für Einfamilienhäuser und große Objekte verfügbar – bezahlbar, effizient und wirtschaftlich. Wie genau ein Eisspeicher ins Heizsystem eingebunden wird und welche Komponenten benötigt werden, zeigt der Beitrag unter anderem anhand eines Beispiels aus der Praxis.
Drei Komponenten
Für das Heizen mit Eis sind drei Hauptkomponenten nötig. Zum Pflichtprogramm gehören ein großer Wasserbehälter, also der Eisspeicher, eine Wärmepumpe und ein Solar-Luftabsorber. Der Eisspeicher ist mit üblichem Leitungswasser gefüllt. Er bevorratet Wärme aus der Außenluft, der solaren Einstrahlung und aus dem Erdreich. Eine Wärmepumpe entzieht via Wärmetauscher diese Wärme, beheizt mit ihr das Gebäude und erwärmt das Trinkwasser.
Dadurch sinkt die Temperatur des Wassers im Speicher bis auf den Gefrierpunkt. Die dabei frei werdende Kristallisationsenergie wird ebenfalls genutzt. Dabei werden je Kilogramm Wasser über 90 Wh freigesetzt. Bei einem kleinen Eisspeicher mit 10 m³ Volumen entsteht so etwa die gleiche Energiemenge, die in 100 l Heizöl enthalten ist. Das Heizöl jedoch wird vollständig verbrannt. Das Wasser des Eisspeichers hingegen steht nach der Regeneration mit Energie aus der Umwelt, aus Luft, Sonne und Erdreich als Wärmequelle erneut zur Verfügung.
Die Sole/Wasser-Wärmepumpe nutzt nicht nur die beim Eismachen entstehende Kristallisationswärme, sondern – und das ist ja ihre eigentliche Aufgabe – die Kondensationswärme beim Komprimieren des Trägermediums. Gleichzeitig kann sie aufgrund der geringen Temperaturunterschiede im Eisspeicher effizient arbeiten.
Heizen und Kühlen
Und: Sie sorgt für eine Kühlung im Sommer. Denn das ist der zweite große Vorteil des Heizens mit Eis: die Kühlung gibt es fast gratis dazu, sieht man von den Stromkosten für die Umwälzpumpe ab. Denn das Eis, über den Winter im Eisspeicher entstanden, nimmt nach und nach die ihm aus den Räumen zugeführte Wärme auf. Technisch handelt es sich um eine Wärmesenke, es wird Wärme aufgenommen, aber keine Kälte abgegeben. …
Geschrieben für SBZ. Der vollständige Beitrag ist hier zu lesen. Zum kostenfreien Probeabo geht es hier.
Ein Beitrag, wie die Zukunft der Wärmenetze aussehen könnte – etwa mit der Befüllung via Solarthermie, haben meine Energieblogger-Kollegen von Ecoquent Positions hier verfasst.





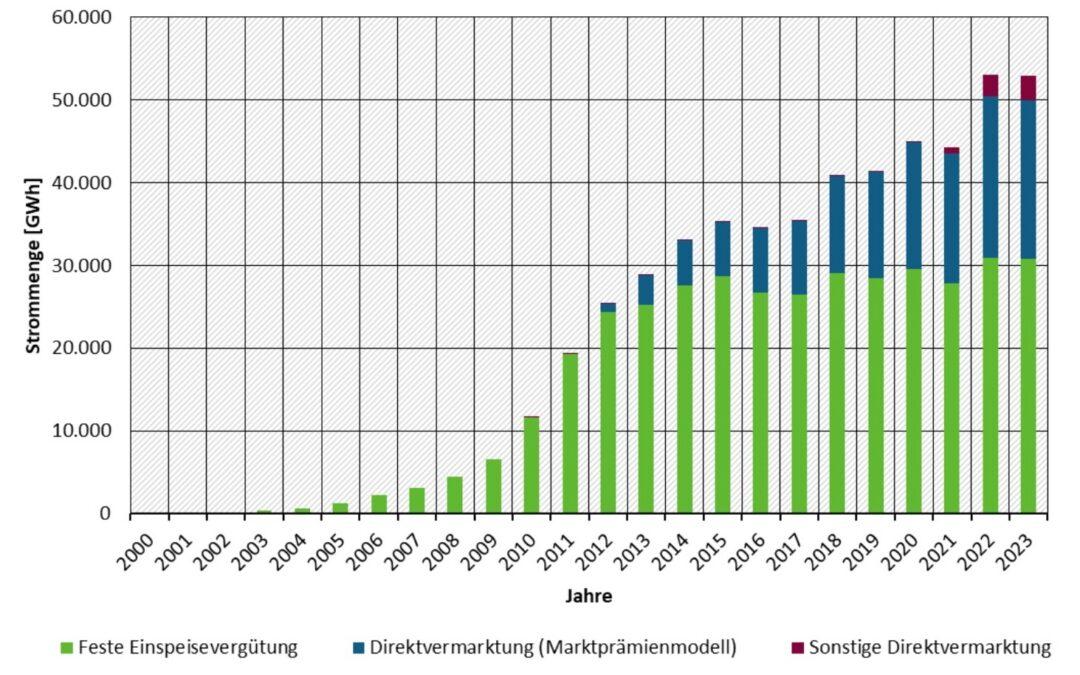
Hallo Jogi, du hast natürlich Recht, im ausführlichen Beitrag wird auch drauf hingewiesen, dass dies eine Lösung ist für Liegenschaften, auf denen nicht genügend Platz für andere Lösungen sind. Und: Bei einer bestimmten Art von Gewerbeimmobilien im Pasivhausstandard ist dies wirklich die bessere Lösung als eine Wärmepumpe.
Tja Frank,
jeder Erdkollektor einer Sole-Wärmepumpe nutzt ebenfalls die freiwerdende Kristallationsenergie beim Gefrieren des Bodens, und die Oberfläche drüber ist der Solarkollektor, bei einem Bruchteil der Kosten. Der Erdkollektor ist zudem genauso für passive oder aktive Kühlung verwendbar und kann genauso auch mit Solarabsorbern kombiniert/regeneriert werden.
Der Aufwand für einen dezidierten Eisspeicher ist im Grunde nur dort gerechtfertigt, wo kein ausreichender Platz für einen Erdkollektor oder Tiefenbohrungen vorhanden ist. Eine Regeneration durch Solarabsorber ist in vielen Fällen hilfreich für den Wirkungsgrad der Wärmepumpen, verhindert jedoch je nach Auslegung und Witterung ggf. weitestgehend eine Eisbildung.
Wobei dann noch zu bedenken ist – Tiefenbohrungen sind deutlich effektiver, da bei diesen die Quelltemperatur meist nicht unter +5°C fällt und somit COP/JAZ der Wärmepumpe spürbar besser ist. Auch zur Kühlung sind Tiefenbohrungen verläßlicher, das sie bei richtiger Auslegung auch nicht wesentlich über +10°C warm werden.
Ich lege derzeit für mein eigenes Haus eine Kombination aus Betonabsorber und Erdkollektor mit dem Ziel aus, ähnliche Soletemperaturen (min +5°C) zu bekommen, wie mit einer Tiefenbohrung.
LG jogi