In Paris lässt es sich trefflich über die Rettung der Welt streiten. Deutschland ist da ganz weit vorn, sieht es sich doch als Musterknabe in Sachen Energiewende. Die stottert jedoch gewaltig. Im Wärmemarkt werden die Erneuerbaren-Ziele von 14 % bis 2020 nimmer erreicht. Statt dessen feiert die gute alte Ölheizung ihr Comeback. Und im Verkehrssektor tut sich wenig bis gar nichts. Nur der Strommarkt glänzt mit jährlich wachsenden Wind- und Solarparks.
Doch auch hier quietscht und knarrt es gewaltig. Aktuell geht es um einen Baustein für den Strommarkt der Zukunft, die sogenannten abschaltbare Lasten. (AbLaV). 2013 wurden diese installiert und bezeichnen Verbrauchseinrichtungen vorrangig in der Industrie, die am Netz der allgemeinen Versorgung oder an einem geschlossenen Verteilernetz mit einer Spannung von mindestens 110 Kilovolt (Hochspannung) angeschlossen sind. Sie nehmen mit großer Leistung nahezu rund um die Uhr Strom ab. Sie sind jedoch in der Lage, ihre Verbrauchsleistung auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber reduzieren zu können. Dafür sind ein fester monatlicher Leistungspreis von 2.500 Euro pro Megawatt und ein variabler Arbeitspreis zwischen 100 und 400 Euro pro Megawattstunde vorgesehen.
Von Industrie nicht genutzt
Die Bundesregierung stellte Anfang Oktober fest, dass bisher 6 Rahmenverträge mit 4 Unternehmen aus der chemischen und der Aluminium-Industrie abgeschlossen. Die Gesamtabschaltleistung betrage 465 MW im Bereich sofort abschaltbarer Lasten und 979 MW im Bereich schnell abschaltbarer Lasten. Die mögliche Kontrahierungsmenge würde damit seitens der industriellen Anbieter bei weitem nicht ausgeschöpft. Für die Industrie wären Vergütungen von 320 Millionen Euro möglich gewesen. 2013 wurden davon 9,7.Millionen Euro genutzt, 2014 knapp 19 Millionen Euro und die ersten drei Monate 2015 8,3 Millionen Euro.
Die Bundesnetzagentur empfahl, die Verordnung auslaufen zu lassen, da im Berichtszeitraum kein Bedarf an abschaltbaren Lasten bestand. Weiter schrieb die Agentur: „Die derzeitige Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten ist darüber hinaus nicht ausreichend geeignet, zusätzliche Potentiale an abschaltbaren Lasten für den Strom- und Regelenergiemarkt zu erschließen. Um die weitere Liquidität des Regelleistungsmarkts sicherzustellen und eine „Kannibalisierung“ des Regelenergiemarktes durch die AbLaV zu verhindern, sollten abschaltbare Lasten daher ihre Abschaltleistung regulär am Regelenergiemarkt anbieten.“
Sinnloses weiterführen
Doch welch Wunder: Der Bundestag sinniert nun darüber nach, dieses offensichtlich sinnlose Instrument weiterzuführen. Das ruft verständliche Kritik auf den Plan. „Die Verordnung zu abschaltbaren Lasten sollte hierfür einen Anreiz geben. Sie konnte ihren Nutzen in der Praxis nicht nur nicht nachweisen, sondern sie erweist sich inzwischen als geradezu energiewendeschädlich“, sagt Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft (bne). Er verweist dabei auf einen aktuellen Bericht der Bundesnetzagentur, der die Wirkung der AbLaV untersucht hat. Laut Behörde hat das Instrument sein Ziel nicht erfüllt und gleichzeitig bestehende Möglichkeiten zur Integration abschaltbarer Lasten, wie den Regelenergiemarkt, negativ beeinträchtigt.
„Letztendlich profitieren nur sehr wenige Unternehmen von der Regelung für abschaltbare Lasten. Die Kosten im dreistelligen Millionenbereich müssen jedoch alle Stromverbraucher tragen. Das trifft den Handel als Branche mit dem drittgrößten Stromverbrauch in Deutschland ganz besonders“, so Kai Falk, Geschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Aus Sicht von HDE und bne böten die im Weißbuch des Bundeswirtschaftsministeriums vorgeschlagenen Maßnahmen genügend Flexibilitätsanreize für industrielle Anbieter. „Eine Verlängerung der Verordnung ist daher auch aus diesem Grund nicht notwendig“, so Falk weiter.
Mehr Netzentgelt?
Völlig unklar ist zudem, ob die Verlängerung der AbLaV sich bereits in den Netzentgelten für das kommende Jahr auswirkt. Die Netzbetreiber haben diese bereits Mitte Oktober bekannt gegeben, die Energievertriebe auf dieser Grundlage ihre Tarife kalkuliert und ihren Kunden mitgeteilt. „Wenn nun wieder alles anders kommt, stellt dies die Lieferanten vor eine große Herausforderung und behindert den Wettbewerb“, so Busch.
Vorschaubild: Die Aluminiumindustie ist eine der wenigen, die bisher die Möglichkeiten der abschaltbaren Lasten nutzte. Foto: LoKiLeCh /Wikimedia /Lizenz unter CC BY-SA 3.0


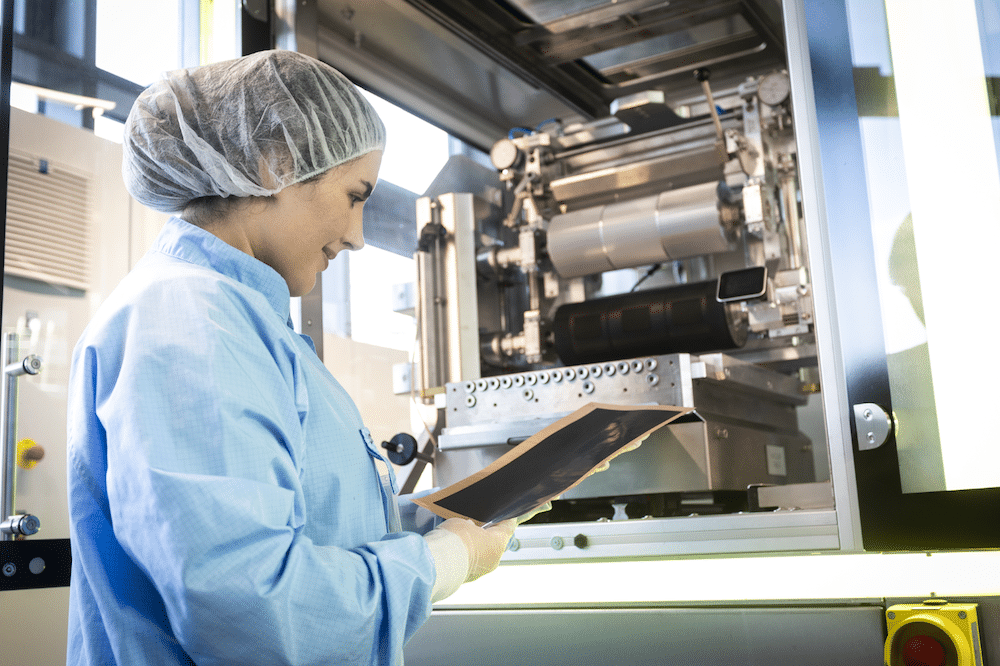



0 Kommentare