Energieeffizienz, zu der auch das Nutzen ansonsten nicht nutzbarer Energie gehört, ist ja das große Thema der Berliner Energietage. Power-to-Heat (PtH), also die Umwandlung überschüssigen Wind- und Solarstroms in Wärmeenergie, ist eines.
In diesem Jahr nun stellte das IWO die Fortführung seines seit 2015 laufenden Praxistests in einem Berliner Einfamilienhaus fort. Demnach betrugen die Erlöse aus Regelenergie und eingespartem Brennstoff 188 Euro im Jahr,. Das ist etwas weniger als in der letzten Bilanz. Aber immerhin – es funktioniert. Hier die technischen Daten der Anlage von Buderus:
- Modulierender Öl-Brennwertkessel, stufenlos 5–15 kW
- 500 Liter Pufferspeicher zur Heizungsunterstützung und Trinkwasserbereitung
- 9 kW Elektroheizer
- PV Anlage
- Nutzung von Überschüssen der hauseigenen PV Anlage sowie negativer Regelenergie aus dem Netz als Wärme
Was nicht funktioniert, ist der politische Rahmen. Denn an diesem darf nur teilnehmen, wer mindestens 5 MW Leistung in die Waagschale zu werfen hat – viel zu viel für ein kleines Einfamilienhaus. IWO und Arge Netz machen aus diesem Notstand eine kleine Tugend und planen nun einen Feldversuch. Die Idee, um in den Regelenergiemarkt kommen: Ein Wärmevertrieb betreibt eine Power-to-Heat-Anlage oder bündelt Hybridheizungen und bezieht in Zeiten von Engpassmanagement Strom von einem Windpark. Zwischen Wärmevertrieb und dem Windpark wird ein Liefervertrag abgeschlossen.
Geplant ist nun eine Modellregion für Power-to-Heat in Hybridheizungen in Schleswig-Holstein, also in genau jenem Bundesland, wo besonders viel Windenergie erzeugt wird. Dabei soll die Ansteuerung der Hybridheizungen durch Integration in das Erneuerbaren Kraftwerk der Arge Netz erfolgen, um so die 5‑MW-Grenze für den Regelenergiemarkt zu knacken. Abgeregelte Strommengen könnten so sinnvoll im Wärmemarkt genutzt werden
Als Projektziele nennt die Arge:
- Nachweis der Systemdienlichkeit
- Ermittlung der integrierbaren Mengen EE in den Wärmemarkt
- Erprobung von geeigneten Geschäftsmodellen
200 Häuser für PtH
„ Etwa 200 PtH-fähige Ölheizungsanlagen mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von jeweils rund 10 kW werden errichtet“, so Björn Spiegel von der Arge Netz. Dabei sei der Austausch veralteter Ölheizungstechnik und die Erweiterung von Bestandsanlagen um PtH-Technologie geplant, sprich: Einige Altanlagen werden einfach mit dem tauchsiederähnlichen Heizstab ausgestattet.
Bleibt abzuwarten, was der Test ergibt. Zwischenzeitlich wird zudem gefordert, einige politische Rahmenbediungen zu ändern. Die Arge Netz fordert deshalb;
- Öffnung der Märkte: Marktintegration heißt, dass erneuerbare Energien jetzt in die Märkte gehen dürfen und Geschäftsmodelle entwickeln können
- Anpassung des Strommarkgesetzes /EEG 2016: Integration einer Option, um Strom, der nicht in das Stromnetz abgegeben werden kann (Engpassmanagement) oder soll (Spitzenkappung), wirtschaftlich nutzbar zu machen. Härtefallregelung und Investitionsschutz bleiben davon unberührt
- Letztverbraucher-Pflichten für Speicher auflösen: Zuschaltbare Lasten aus Power-to-X-Lösungen sind keine Letztverbraucher und müssen von Steuern und Abgaben befreit werden
Wissenschaft fordert Marktöffnung
Rückendeckung erhalten IWO und Arge Netz bei ihrem Vorhaben von der Stiftung Umweltenergierecht und dem Fraunhofer ISI. Die haben im März 2016 ein Gutachten zu zuschaltbaren Lasten vorgestellt. Sie empfehlen:
- Ausschreibungen von zuschaltbaren Lasten zur Nutzung von ansonsten abgeregeltem Strom einführen
- Pflicht zur Ausschreibung zuschaltbarer Lasten durch ÜNB/ggf. VNB (also die Netzbetreiber)
- Pflicht zum Einsatz kontrahierter Lasten vor Abregelung EE – damit dürfte auch die 5‑MW-Grenze fällig sein
- Dafür Privilegierungen bei staatlich induzierten Strompreisbestandteilen
- Alternative: rückwirkende Kostenerstattung
Alle Vorträge zu dem PtH-Test finden sich hier.
Ein Beitrag zu den Chancen von Smart Home, letztlich auch eine Voraussetzung von Power-to-Heat im Eigenheim, findet sich hier von Energieblogger-Kollege Martin Schlobach auf Stromauskunft.


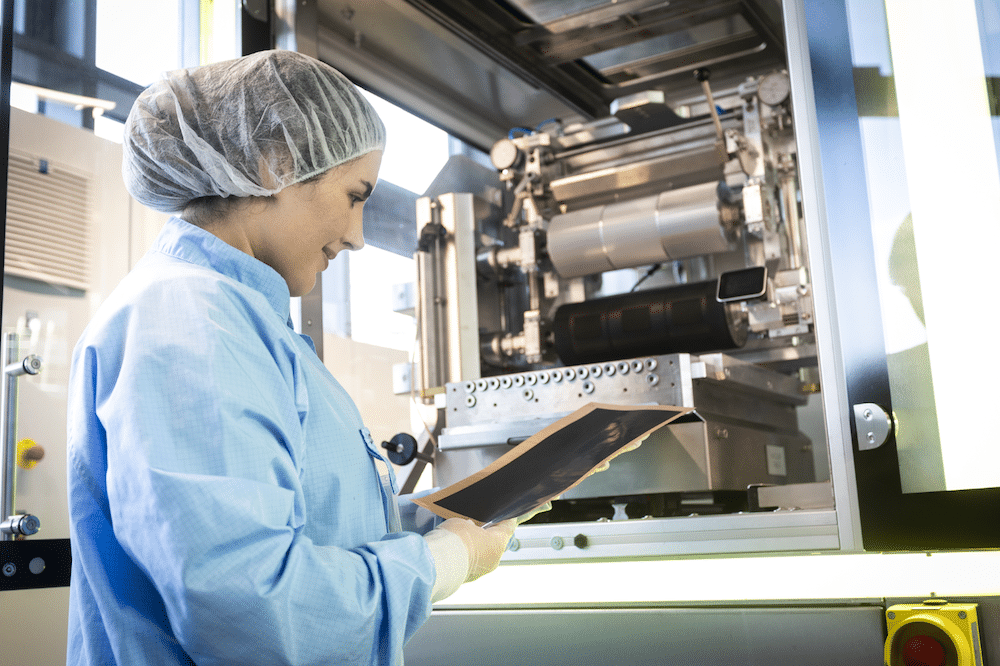



Zwar ist es löblich, alte Öl-Heizwertkessel zu Brennwertkesseln aufzurüsten und sowieso mit sonst nicht genutztem Strom ein wenig Öl ersetzen zu lassen, aber so wird nichts draus, am Ende (2050) nur mit EEN Strom zu heizen.
Zielführend wäre, den Verbrauch auf max. ~ 5kW zu reduzieren, eine WP mit großem Wärmespeicher zu installieren und dann die Stromüberschüsse zum Laden des Speichers zu nutzen.
Bei max 5kW ist der Tagesbedarf die allermeiste Zeit ca 50kWh/Tag. Diese 50kWh lassen sich z.B. in 2000l Speicher mit einem Temperaturhub von 21,5K einspeichern. Zwar wird der COP in einem solchen Fall nicht mehr optimal sein, aber immer noch deutlich besser, als bei einer Direktheizung.
Mit dem Praxistest wird wenigstens angegangen, ansonsten abgeregelten Strom zu nutzen und da endlich in die staatlichen Regelungen etwas Bewegung zu bringen.
LG jogi