Heute geht es weiter mit unserer Interview-Serie zur Zukunft der PV-Speicher. Mathias Bloch von Sonnenbatterie meint, dass viele Interessenten vollkommen falsche, viel zu hohe Preisvorstellungen haben. Allerdings: Große Preissenkungen wie vor zwei Jahren mit 50 % seien auch nicht mehr drin.
Ab wann erwarten Sie den breiten wirtschaftlichen Durchbruch für Stromspeichersysteme?
Wir sehen häufig einen Unterschied in der öffentlichen Wahrnehmung des Preises von Stromspeichern und dem tatsächlichen Preis. Viele Interessenten haben Kosten von 15.000 bis 20.000 Euro oder mehr im Hinterkopf und sind überrascht wenn sie sehen, dass sie bei uns schon ein anschlussfertiges Komplettsystem ab 5.475 Euro brutto bekommen.
Unsere Stromspeicher sind heute bereits sehr wirtschaftlich. Sie amortisieren sich bei richtiger Dimensionierung innerhalb von 10 bis 12 Jahren. Danach erzeugt der User noch mindestens ein Jahrzehnt lang kostenlosen Strom. Wie diverse Studien belegen, liegt die Lebensdauer von PV-Modulen bei rund 25 bis 30 Jahren, also weit über ihrem Abschreibungszeitraum von 20 Jahren. Unsere Speichersysteme erreichen eine Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen und sind für mindestens 20 Jahre ausgelegt.
Wie bei allen Technologien werden die Preise noch ein Stück zurückgehen allerdings nicht mehr in dem Maß, wie das bisher geschehen ist. Die Technologie ist mittlerweile soweit ausgereift, dass Preissenkungen von 50 Prozent, wie die Sonnenbatterie sie 2014 gemacht hat, nicht mehr möglich sein werden.
Einen Preis für die kWh/Speicherkapazität zu nennen halten wir nicht für sinnvoll, da es keine Rückschlüsse über die Qualität der Batterien wie Langlebigkeit und Sicherheit sowie den Ausstattungsgrad des Speichersystems zulässt. Zum Beispiel lässt sich ein vollintegriertes und intelligentes Komplettsystem wie die Sonnenbatterie nicht mit einem bloßen Batterieblock vergleichen, der keinerlei Anschlüsse oder Software hat.
Welche Vorteile haben aus Ihrer Sicht Stromspeicher gegenüber Wärmespeichern, etwa der Power-to-Heat-Technologie, die ja auch überschüssigen PV-Strom in Form von Warmwasser speichern könnte?
Unser Ziel ist es, dass der Eigenverbrauch des Kunden so hoch wie möglich ist. Die Nutzung von überschüssigem Solarstrom für die Aufbereitung von warmen Wasser halten wir also für eine sinnvolle Ergänzung für einen Stromspeicher. Die Sonnenbatterie hat zum Beispiel bereits die entsprechenden Schnittstellen, um einen Heizstab zu aktivieren oder eine Wärmepumpe anzuschließen. Das ermöglicht den Usern eine noch effizientere Nutzung ihres selbst erzeugten Stroms und spart am Ende noch mehr Geld.
Welche grundlegenden Unterschiede sehen Sie zwischen der bleibasierten und der Lithium-basierten Speichertechnologie?
Grundsätzlich finden wir, dass Blei-Speichersystemen technisch überholt sind. Blei hatte lange Zeit den Vorteil, dass es noch etwas günstiger als Lithium war allerdings ist die Differenz in den letzten anderthalb Jahren deutlich kleiner geworden, so dass die Vorteile der Lithium-Technologie klar überwiegen.
Als Vorteile der Lithium-Speicher sehen wir folgende Punkte:
- deutlich höhere Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen im Vergleich zu 2.500 Ladezyklen bei Blei
- deutlich kompaktere Bauweise und niedrigerer Platzbedarf da viel höhere Energiedichte
- keine Wartungskosten wie sie z.B. beim Auffüllen mit Wasser bei Blei-Akkus notwendig machen
- Wirkungsgrad von Blei-Akkus ist mit rund 50 bis 60 % deutlich niedriger als der von Lithium-Akkus (über 90 %), es geht also viel weniger Energie beim Laden/Entladen verloren
- Entladetiefe von 100 % möglich während Blei durchschnittlich nur 50 % erreicht
Welcher Systeme haben Sie für die verschiedenen Wohnungsgrößen im Angebot?
Die Sonnenbatterie bietet in Deutschland Speichersysteme mit unterschiedlicher Kapazität und Leistungen an. Damit bieten wir flexible und passgenaue Systeme für jeden Haushalt an. Die kleinste Sonnenbatterie für Haushalte mit einem sehr niedrigen Energieverbrauch hat eine Kapazität von 2 kWh und einer Dauerleistung von 1,5 kW. Bei den weiteren Modellen geht es in Schritten von 2 kWh weiter, die sich an die unterschiedlichen Haushaltsgrößen anpassen. Die größte Sonnenbatterie mit einer Kapazität von 16 kWh und einer Dauerleistung von 3,3 kW eignet sich auch für Mehrfamilienhäuser.
Welche der Speicheroptionen – Hausspeicher oder Ortsnetzspeicher – halten Sie grundsätzlich für effektiver?
Wir halten netzdienliche Hausspeicher wie die Sonnenbatterie für die effektivere Variante wenn es darum geht, die Verteilnetze zu entlasten. Spannungsspitzen sind ja von der Leitungslänge abhängig, die höchste Belastung tritt also am Ende des Niederspannungsnetzes auf. Bestes Beispiel sind ja große PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Gebäuden, die häufig abseits liegen und gerade am Mittag eine hohe Belastung für das Ortnetz darstellen. Zentral gelegene Ortsnetztrafos können das Netz also nie in dem Maß entlasten wie Hausspeicher, die Spannungsspitzen direkt dort kompensieren, wo sie auch auftreten.
In welchem Fall halten Sie die Nachrüstung von PV-Anlagen mit Speichern zur Eigenverwendung für sinnvoll, die bisher nur für die Einspeisung ausgelegt waren?
Wir halten eine Nachrüstung für alle PV-Anlagen sinnvoll, die ab 2009 ans Netz gegangen sind. Zwischen 2009 und 2012 wurde der Eigenverbrauch ja vergütet. Besitzer einer PV-Anlage aus dieser Zeit können ihre Anlage im Nachhinein einmalig auf Eigenverbrauch ummelden und können so noch in den Genuss der Förderung kommen. Ein Stromspeicher ist hier durchaus sinnvoll, da er die Menge des selbst genutzten Stroms deutlich erhöht.
Aber auch für PV-Anlagen die nach der Eigenverbrauchsvergütung installiert wurden ist die Nachrüstung mit einem Speicher sinnvoll, da die Einspeisevergütung deutlich unter dem heutigen Strompreis liegt. Insofern sparen Speicherbetreiber in der Regel mehr ein wenn sie ihren Strom selbst nutzen als sie für den Strom noch bekommen würden. Dazu kommt, dass die Ende des Jahres auslaufende Speicherförderung der KfW auch für Anlagen gilt, die ab 01.01.2013 in Betrieb gingen. Nachrüster können also nochmal zusätzlich bis zu 30 Prozent des Anschaffungspreises sparen.
Welche Lösungen bieten Sie dafür an?
Die Sonnenbatterie ist ein AC-gekoppeltes Speichersystem und kann damit unabhängig von der Größe der PV-Anlage oder vom Wechselrichter nachgerüstet werden.
Gibt es dafür bereits Refinanzierungs-Rechnungen?
Eine seriöse Refinanzierungsrechnung hängt von zahlreichen, sehr individuellen Faktoren ab. Wir bieten Kunden eine ausführliche und maßgeschneiderte Rechnung an, an der er sich orientieren kann.
Ein Beitrag, wie man auch aus Apfelresten einen PV-Speicher herstellen kann, findet sich hier bei meinen Energieblogger-Kollegen von energyload.
Der erste Teil dieser Serie, „PV-Speicher: Durchbruch hat bereits stattgefunden”, findet sich hier.
Der zweite Teil, „PV-Speicher: Egal ob Blei oder Lithium – alle Batterien sind gut“, ist hier zu lesen.


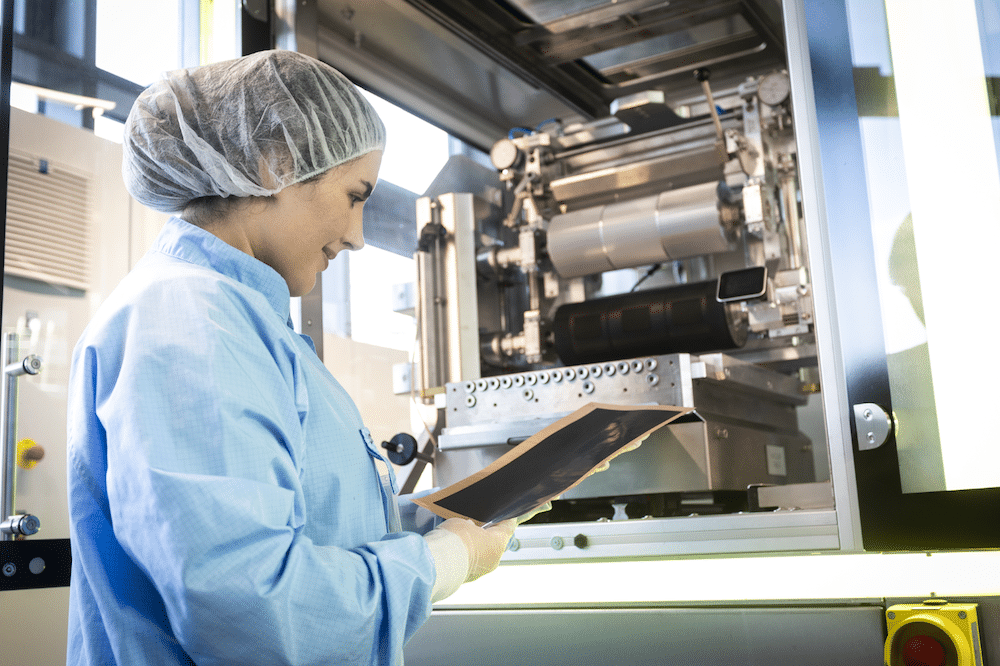



Guten Tag,
ein interessanter Punkt ist auch das Recycling der Zellen. Während Bleizellen von den meisten Herstellern zur Wiederaufbereitung zurückgenommen werden (was bei angepeilten 20 Jahren Nutzungsdauer und mehr ja mehrmals der Fall sein wird), werden Lithium Zellen derzeit nur thermisch behandelt. Das heißt, sie werden verbrannt und die Metalle werden wiederverwertet. Macht aber nichts, denn Lithium macht ohnehin nur 3–4% einer Zelle aus (lt. Prof. Wilkening, Uni Graz).
Ich habe mir die Kosten pro gespeicherter kWh auf einen Zeitraum von 25–30 Jahren ausgerechnet, inklusive Steuer und unter Berücksichtigung eines Tauschs des Akkupacks (bei Blei bis zu 5 Mal!). Die spezifischen Kosten betragen bei Blei 31,48 ct/gespeicherter kWh, bei Lithium auf den selben Zeitraum knapp über 14 ct/kWh. Das zeigt, dass die niedrigeren Anschaffungskosten bei Blei höheren Re-Investitionskosten gegenüberstehen.
Interessant wäre jetzt nur noch der ökologische „Fußabdruck” der Herstellung einer kWh Bleispeicher vs. 1 kWh Lithiumspeicher (LiFePO4 et. al.). Gibt es hierzu etwas?
Danke, Herr Heiller, für die interessanen Berechnungen. Zum Öko-Fußabdruck kenne ich noch nichts, ist aber ein interessanter Aspekt,den ich in diesem Blog aufgreifen werde.