Noch nie stand die Heizung so sehr im Fokus von Medien und Politik. Kein Wunder, schlummern gerade im Keller die größten Einsparpotenziale und somit eine wesentliche Voraussetzung für die Energiewende.
Seit diesem Jahr wird zudem der Umstieg auf eine neue Heizung und die Einkopplung von Erneuerbaren Energien so gut gefördert wie noch nie. Doch welche alte oder neue Energie oder gar ein Mix aus beiden sind für Immobilien ideal?
Eine erste Überlegung sollte darauf abzielen, was man eigentlich will (siehe hierzu auch Immobilienwirtschaft 5/2016, Heizung, wechsel dich … ab Seite 58). Eine Wahl ist immer auch davon abhängig, was man beheizen möchte. Ist es ein Neubau oder ein Bestandshaus? Wird es tagsüber stark genutzt, etwa bei Bürogebäude, oder ganztägig, etwa ein Altenheim? Generell gilt: Neubauten lassen sich besser mit Erneuerbaren Energien beheizen als Bestandsbauten. Häuser, in denen tagsüber mehr Energiebedarf herrscht als nachts, lassen sich ebenso besser mit Solarthermie oder Photovoltaik versorgen.
Hybride sparen Kosten, schonen die Umwelt
Hybride, also die Nutzung mehrerer Brennstoffe, helfen dabei, die Kosten auch zukünftig niedrig zu halten, weil man nie von nur einem Energieträger abhängig ist. Zudem ist es durch die EnEV 2016 quasi unmöglich, ohne Erneuerbare Energien eine Neubau-Immobilie zu heizen.
Ist die Entscheidung für die Heizungsart gefallen, sollte immer das miteinander kombiniert werden, was man gemeinsam speichern kann. Verfügt man über einen Warmwasser-Pufferspeicher, der mit Gas oder Öl beheizt wird, sollte die zweite Wärmequelle auch eine sein, die ihre Wärmeenergie dorthin geben kann. Dabei bietet sich Solarthermie an. Aber auch die Einkopplung von Biomasse ist möglich, ein Kamin, mit Scheitholz oder Pellets betrieben, mit eingekoppelt werden kann.
Gleiches mit Gleichem kombinieren
Anders herum: Fällt eine Wahl pro Wärmepumpe, wäre es nur logisch, statt Solarthermie eine Photovoltaik-Anlage zu installieren, da deren Strom direkt oder via Stromspeicher von der Wärmepumpe genutzt werden kann. Diese Kombination hat gegenüber der solarthermischen Variante gleich mehrere Vorteile. Überschussstrom kann ins Netz eingespeist oder selbst genutzt werden. In Deutschland gibt es schon erste Regionen, wo Solarstrom billiger erzeugt werden kann als der aus dem Netz bezogene. Die Installation einer PV-Anlage ist deutlich unkomplizierter als die einer solarthermischen. Beide Vorteile macht sie kostenseitig interessanter.
Doch wann sind diese Kombinationen effizient, wie sollte ein Mix der Energieträger aussehen? Und welche Deckungsgrade sollten durch die erneuerbaren Komponenten überhaupt erreicht werden, damit sich die deutlich höhere Investition überhaupt lohnt?
Gekürzt. Geschrieben für Immobilienwirtschaft. Der vollständige Beitrag erschien in der Nummer 10/2016. Er ist auch hier online ab Seite 90 zu lesen. Zum Abonnement der Zeitschrift Immobilienwirtschaft geht es hier.
Über den klimaneutralen Gebäudebestand berichtet Energieblogger-Kollege Björn Katz hier auf seinem Blog Stromauskunft.




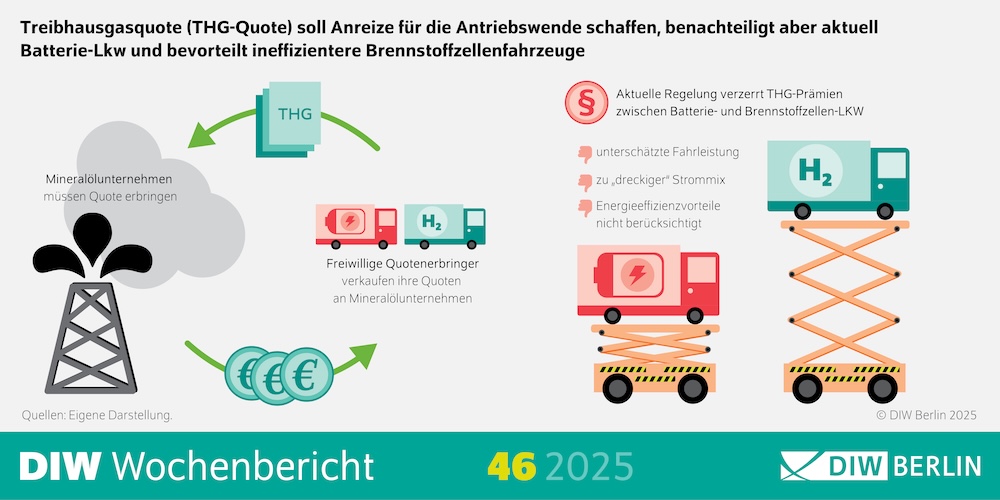
0 Kommentare