Das Münchener IGT – Institut für Gebäudetechnologie gibt monatlich Tipps heraus, mit denen Mietern, Verwaltern und TGA-Verantwortlichen die Steuerung der Haustechnik leicht gemacht werden soll. Im Februar nun zeigen die Wissenschaftler, wie man mit eigenem PV-Strom einen maximalen Autarkiegrad erreicht.
Wie weit kann eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) den elektrischen Energiebedarf
eines Wohngebäudes so decken, dass eine maximale Autarkie – d.h. möglichst geringe Abhängigkeit vom öffentlichen Energieversorger – erreicht wird? Welche Dimensionierung ist optimal? Ist es sinnvoll, einen lokalen Batteriespeicher zu nutzen und wenn ja, in welcher Größenordnung?
Diesen Fragen hat sich Natalie Stut im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an der
Hochschule Rosenheim gewidmet. Ein paar wesentliche Erkenntnisse werden in diesem „Tipp des Monats“ zusammengefasst.
Reale Messwerte als Grundlage
Grundlage der Arbeit waren konkrete, im Minutentakt gemessene Strombedarfswerte eines „echten“ Familien-Wohngebäudes bestehend aus der Haushaltslast, der elektrischen Last (Ladeleistung) eines Elektrofahrzeugs und der Stromerzeugung einer PV-Anlage. Um die Sinnhaftigkeit eines lokalen Batteriespeichers beurteilen zu können, wurde dieser später fiktiv ergänzt, also in Bezug auf den Batteriespeicher wurden keine echten Messwerte, aber ein hinreichend plausibilisierter simulierter Einfluss auf die Energieströme verwendet.
Jedes Mal wurden die Energiebilanzen aufgestellt und Bewertungen hinsichtlich der Autarkie und des Eigenverbrauchs dargestellt. Basierend auf diesen Analysen wurden Aussagen für die unterschiedliche Dimensionierung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher ermittelt.
Es wurde ermittelt, dass nur eine Kombination aus beidem eine hohe Autarkie ermöglicht. Bei realistischen Größenordnungen von PV-Anlage und Batteriespeicher kann eine Autarkie von bis zu 80% erreicht werden. Bei geringer PV-Nennleistung hat die Größe des Batteriespeichers keinen signifikanten Einfluss auf die Autarkie. Ein Batteriespeicher macht sich erst ab PV-Nennleistungen von 5 bis 10 kW bemerkbar. …
In Bezug auf die Praxis ist zu bedenken, dass PV-Anlagen günstiger als Batteriespeicher sind. Genauer gesagt: Die Kosten pro kW bei PV-Anlagen sind niedriger als die Kosten pro kWh bei Batteriespeichern. Damit erscheint es sinnvoll, die Kapazität eines Batteriespeichers so auszulegen, dass deren Kapazität bei ca. 1/3 bis 2/3 der Nennleistung der PV-Anlage liegt.
Im Haushalt des Wohngebäudes lebten zur Zeit der Messungen immer zwischen 3 und 4 Personen. Der Messzeitraum betrug 10,5 Monate und umfasste alle Jahreszeiten. Der auf einen Jahreszeitraum hochgerechnete Energiebedarf für Strom lag bei 1.749,71 kWh. Das ist für einen 3–4 köpfigen Haushalt ein ausgesprochen niedriger Wert. Im Haus wurde auch eine elektrische Lüftungsanlage mit integrierter elektrischer Heizung betrieben. Der dazu nötige Jahresbedarf lag bei weiteren 1.768,17 kWh. In Summe ergibt sich somit ein jährlicher Energiebedarf von 3.517,88 kWh. Dies ist ein Wert, wie er für einen „normalen“ Haushalt (d.h. 3–4 Personen im Haushalt, durchschnittlich energiesparende Lebenseinstellung; Heizung über Öl/Gas/Pellets) zu erwarten ist und somit ist diese Basis auf andere „normale“ Häuser übertragbar.
Auch der Energiebedarf für das Laden eines E‑Fahrzeugs wurde berücksichtigt. Dabei muss beachtet werden, dass dieses meist tagsüber geladen wurde und somit direkt den PV- Ertrag (ohne Zwischenspeicherung) verwenden konnte. Der auf einen Jahreszeitraum hochgerechnete Energiebedarf für das E‑Fahrzeug lag bei 879,94 kWh. Bei einem angenommenen „Verbrauch“ von 15 kWh/100km entspricht dies einer Laufleistung von 5.866 km. Dies erscheint grundsätzlich realistisch, da ein E‑Fahrzeug nicht nur zu Hause geladen wird, sondern auch an öffentlichen, derzeit sogar meist kostenlosen, Ladestationen.
Diese Randbedingungen sind für die Übertragung auf andere Gebäude zu beachten; bei einem elektrischen Gesamtenergiebedarf (aufgrund anderer Haushaltsgröße, anderen Lebenseinstellungen der Bewohner oder einen anderen Strombedarf für das E‑Fahrzeug) sind die dargestellten Aussagen entsprechend anzupassen.
Der Tipp des Monats des IGT kann hier abonniert werden.
Mit dem Smart Home, ohne dass sich eine moderne TGA-Anlage kaum sinnvoll steuern lässt, befasst sich auch Energieblogger-Kollege Björn Katz hier auf seinem Blog Stromauskunft.


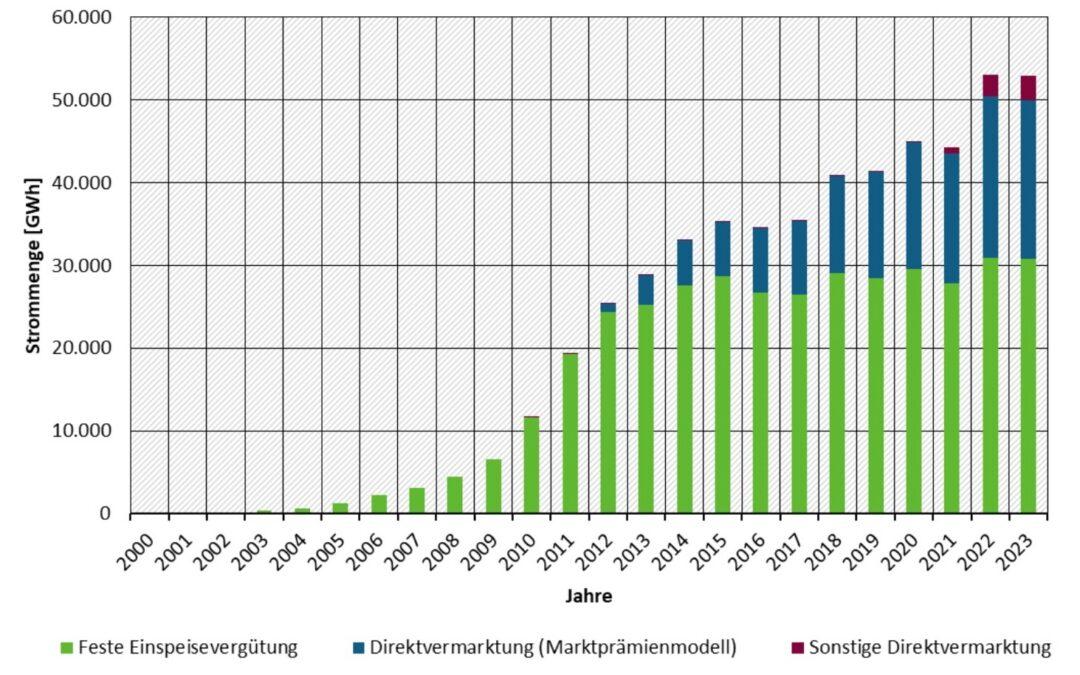


Danke für das Lob. Eure Anmerkungen geb ich gern weiter. ist auch sehr interessant für mich.
Hallo Frank Urbansky, ich könnte mir vorstellen, dass die Bachelorarbeit von Natalie Stut schon eine Weile alt ist bzw. auf alten Daten basiert. Unsere Branche ist auch extrem im Wandel. Demnächst kommt noch massiv die Elektromobilität, die wir mit in die PV-Anlagen /Ladesysteme einbinden müssen. Das wird noch einmal die Welt völlig verändern. Übrigens vielen Dank für die vielen guten Artikel in der Vergangenheit auf Ihrer Seite.., musste mal gesagt werden :).
Ich geb das mal ans IGT weiter, danke für die Hinweise.
Zusatz: im Text sind natürlich 1300–1700 Euro je kWp gemeint 🙂 – Eine 5 kWp Anlage kostet daher 6500 – 8500 Euro netto.
„In Bezug auf die Praxis ist zu bedenken, dass PV-Anlagen günstiger als Batteriespeicher sind. Genauer gesagt: Die Kosten pro kW bei PV-Anlagen sind niedriger als die Kosten pro kWh bei Batteriespeichern. Damit erscheint es sinnvoll, die Kapazität eines Batteriespeichers so auszulegen, dass deren Kapazität bei ca. 1/3 bis 2/3 der Nennleistung der PV-Anlage liegt.”
Gerade im Speicherbereich hat sich einiges getan. So ist es in der Praxis mittlerweile so, dass die Realität obige Aussage völlig verkehrt hat. Einen ca. 10 kWh Li-Ionen Speicher bieten wir mittlerweile für unter 8000 Euro netto an. Wohnt der Kunde in Sachsen, muss er sogar durch die aktuelle SAB-Förderung nur ca. 5000 Euro netto zahlen. Wir liegen somit bei ca. 800 Euro /kWh. Eine 5 kWp Anlage bekommt man bei uns zwischen 1300 und 1700 Euro – je nach Ausstattung und Material.
Auch die Aussage zur Speichergröße ist völlig marktfern. Grundsätzlich werden immer größere Speicher verbaut. Z.B. liegen zwischen einer Investition in einen 6,6 kWh Speicher und einen mit 9,3 kWh nicht einmal mehr 1000 Euro Differenz. Aus Haltbarkeitsgründen sowie auch um den Eigenverbrauch zu erhöhen, ist daher die Anschaffung von kleineren Speichern nicht mehr sinnvoll. Entsprechend dem Artikel müsste man für eine 5 kWp-Anlage einen 2–4 kWh Speicher planen. Aus unserer täglichen Praxis können wir sagen, dass dies kein Kunde mehr möchte. Wir bauen ab 4 kWp-Anlagen (kleine Dächer auf Reihenhäusern) immer die 10 kWh-Speicher ein. Vorausgesetzt die Verbräuche sind vorhanden, ist das ein sehr gutes Verhältnis. Aus Gründen des technologischen Fortschritts raten wir derzeit jedoch auch bei 10 kWp-Anlagen von deutlich größeren Speichern ab (obwohl auch das einige unserer Kunden kaufen). In spätestens ca. 5 Jahren rechnen wir damit, dass die Tendenz eher zu 20–30 kWh-Speichern geht – und diese zunehmend mit Ersatzstromfunktionen ausgestattet sein werden. Mal sehen wohin die Reise geht :). Es bleibt auf jeden Fall extrem spannend!