Die Grünen beginnen schon den Bundestagswahlkampf – jedenfalls auf energiepolitischem Gebiet.
In ihrem aktuellen Antrag „Klimaschutz in der Wärmeversorgung sozial gerecht voranbringen – Aktionsplan Faire Wärme starten“ zählen sie allerhand Maßnahmen auf, darunter einige alte Hüte, aber auch einige neue Forderungen.
Zur Realisierung hätten die Pläne nur dann eine Chance, wenn die Grünen in die Regierung kommen und den dann möglichen Partner SPD davon überzeugen, denn die Sozialdemokraten lehnen die meisten der Forderungen ab. Ob R2G, also die Koalition aus SPD, Linken und Grünen, kommt, kann derzeit jedoch noch niemand sagen. An dieser Stelle seien die wichtigsten Punkte mit Kommentierung vorgestellt.
7 Mrd. für Wärmemarkt
Die bereit gestellten Mittel für erneuerbare Wärme, energetische Sanierung und Infrastruktur für die Wärmeversorgung sollen auf insgesamt 7 Milliarden Euro jährlich verdoppelt und die Antragsverfahren vereinfacht werden, damit die Förderung ankommt und gezielt wirkt.
Sehr gut.
Das Steuer- und Abgabensystem im Energiesektor soll so weiterentwickelt werden, dass sich der CO2-Ausstoß eines Energieträgers stärker im Preis widerspiegelt und die bestehende Bevorteilung von Heizöl gegenüber anderen Brennstoffen abgebaut wird.
Sprich: Energiesteuer für Heizöl, Erdgas und Flüssiggas sowie Kohle anheben.
Das Regelungsdickicht im Gebäudebereich soll durch ein einfacheres und transparentes Energiesparrecht ersetzt werden, das die CO2-Emissionen und den realen Wärmebedarf
eines Gebäudes zu den wesentlichen Bemessungsgrößen macht.
Ersteres wird durch das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Angriff genommen. Letzteres ist mit der derzeitigen Regierung nicht zu machen und wahrscheinlich auch nicht mit der SPD als möglichen Koalitionspartner.
Gegen Technologieoffenheit
Die staatliche Subventionierung neuer Öl- oder Gasheizungen über die KfW wird ab sofort eingestellt und stattdessen das Marktanreizprogramm für Erneuerbare im Wärmemarkt (MAP) verbessert und aufgestockt.
Genau das widerspricht dem technologieoffenen Ansatz der Regierung, der auch von der SPD getragen wird.
Der von der EU vorgeschriebene Niedrigstenergie-Gebäudestandard für Neubauten wird entsprechend dem KfW-Standard Effizienzhaus 40 definiert. So kommen spätestens ab 2021 kaum noch Heizungen im Neubau zum Einsatz, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind.
Die Regierung tendiert eher zum KfW-55-Standard als Niedrigstenergiehaus.
Erneuerbare verpflichtend auch im Bestand
Der Einsatz erneuerbarer Energien wird auch im Gebäudebestand anteilig verpflichtend, wenn ohnehin ein Austausch der Heizungsanlage erforderlich ist, so dass Erdöl und Erdgas auch im Bestand bis 2040 schrittweise und planbar weitestgehend durch erneuerbar betriebene Heizsysteme ersetzt werden.
Gleiches ist mit dem EWärmeG in Baden-Württemberg eher gescheitert, Hausbesitzer zögern Sanierungen hinaus.
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen werden durch eine entsprechende Ausgestaltung der KWK-Förderung verstärkt von Mineralöl‑, Kohle- und Erdgasbetrieb auf Abwärmenutzung (sollte ja eigentlich Standard sein, dank an Jonas für den Hinweis, FU) oder erneuerbare Brennstoffe umgestellt.
Das ist schwierig, weil hier Erdgas der bestimmende Brennstoff ist und eine Umstellung technisch äußerst kompliziert, wenn nicht gar unmöglich ist. Ausnahme: Wasserstoff oder Biogas als Erdgasersatz.
Wärmenetze sollen für die Einspeisung erneuerbarer Wärme sowie industrieller und gewerblicher Abwärme durch gesetzliche Regelungen geöffnet werden, um auch die Nah- und Fernwärmeversorgung schrittweise zu dekarbonisieren.
Löblich, hier müsste die aktuelle Gesetzeslage komplett geändert werden. Die Netzbetreiber mit ihren Quasi-Monopolen sind nicht wirklich verpflichtet, die Angebote von Dritten in ihr Netz aufzunehmen.
Temporäre Überschüsse an Wind- und Solarstrom über Power-to-Heat-Anwendungen zur Wärmeerzeugung genutzt werden und so zur Sektorenkopplung zwischen Strom- und Wärmemarkt beitragen.
Sehr gute Idee, hat trotz ihrer Ineffizienz noch am ehesten den Ansatz einer praktikablen Lösung.
Auch die anderen Parteien kommen hier an dieser Stelle zu Wort, wenn sie sich dezidiert zum Thema Wärmewende äußern.
Über die Photovoltaik im EEG 2017, von dem auch das neue GEG berührt ist, schreiben die Energieblogger-Kollegen Franz-Josef Kemnade und Christian Sperling von nextkraftwerke hier.


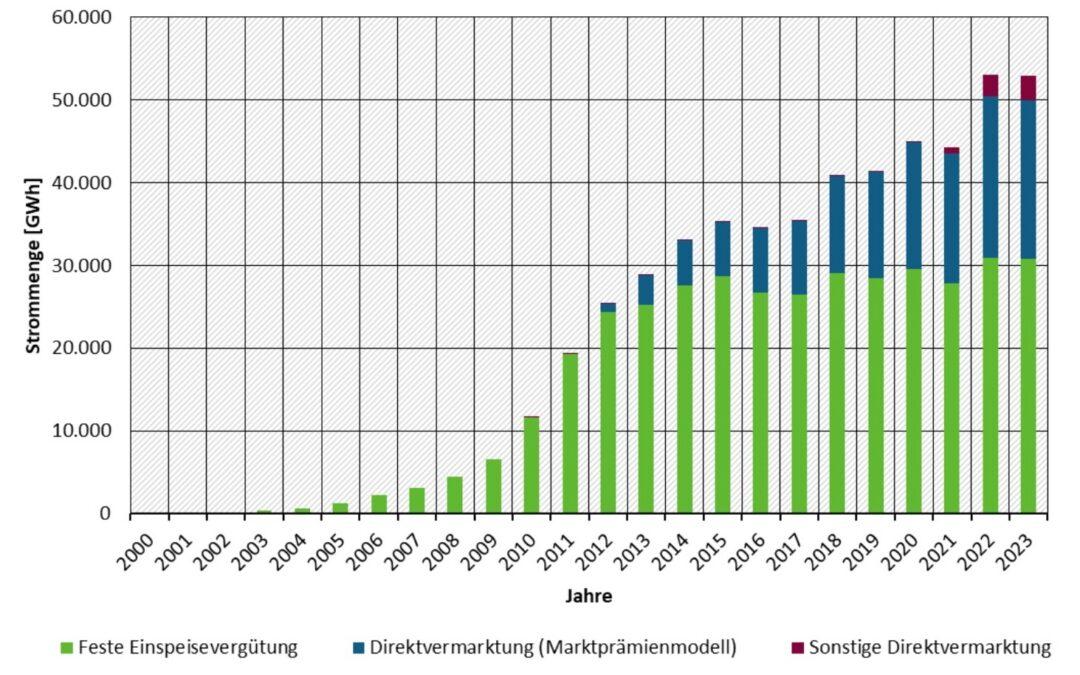


Mit 1 kWh Strom „verheizt” kann man ja immerhin 1 kWh Erdgas einsparen – mit Wärmepumpe entsprechend mehr.
1 kWh Strom kostet zumindest bei großen PV-Anlagen bald weniger als 1 kWh Erdgas (Endkundenpreise), Windkraft kostet im Norden auch nicht mehr als Erdgas. Also sogar „wirtschaftlich” das verheizen vno Strom…
Wobei ein Nahwärmenetz mit Niedertemperatur (< 30°C Vorlauf) und Solarthermie und Wärmepumpe betrieben eine interessante „Energiesenke” wäre 🙂
Was ist denn Ineffizient am verheizen von temporären Überschüssen von Wind- und Solarstrom? Es ist effizienter als abriegeln und Effizienter als Poer to Gas.
Verglichen mit PtG ist PtH sicher effizient, aber generell ist das direkte Heizen mit Strom ineffizient.